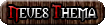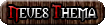|
*dieser Thread soll dazu dienen den Waffen auf Siebenwind mehr rollenspielerische Tiefe zu verleihen und somit die Sicht ein wenig von dem reinen "Enginewerkzeug" zu distanzieren.
Sofern man der Quelle glauben mag sollte, ist das alles historisch Korrekt. Wer den Quellennachweis haben will um mehr Informationen darüber zu erhalten soll mir eine PN schicken*
-------------------------------------------------------------------------
Der Säbel:
Der Säbel war insbesondere bei leichten Kavalleristen späterer Zeit beliebt, wo er eine gute Ergänzung zu den ersten Feuerwaffen mit langer Nachladezeit darstellte. Die im 15. Jahrhundert aufkommenden Säbel wurden auch von Infanteristen als leichtere Zweitwaffen getragen.
Auch unter den Säbeln gibt es viele exquisit verzierte Stücke. Fechtkenntnisse sollten vorhanden sein, um mit dieser Waffe umzugehen. Der Säbel wird in der Regel von darauf spezialisierten Kämpfern im Einwaffenstil ohne Schild verwendet. Der Säbel kann auch im engen Handgemenge verwendet werden, aber die Wucht beim Schlagen ist geringer als beim Schwert, da die Waffe aufgrund der schmaleren und dünneren Klinge leichter ist. Allerdings ist die Schneide schärfer geschliffen, und der Schwerpunkt der Klinge liegt im vorderen Drittel, so daß Säbelhiebe "gezogen" werden können, um die Schneidwirkung noch zu erhöhen. Die Klingenformen können allerdings sehr stark variieren.
------------------------------------------------------------------------
Das Kurzschwert:
Als leichte einhändige Waffe eignet sich das Kurzschwert gut als Zweitwaffe oder als leichte Nahkampfwaffe für Bogen- oder Armbrustschützen. Auch Krieger, deren Hauptwaffe nicht das Schwert ist, die aber dennoch die Notwendigkeit sahen, eine zusätzliche Klingenwaffe bei sich zu führen, die beträchtlichen Schaden anrichtet, hatten ein Kurzschwert an ihrer Seite baumeln. Auch für Krieger, die ein behinderndes Waffengewicht scheuten, war das Kurzschwert ideal. Es ist leicht genug, um in einem Kampf mit zwei Waffen als Sekundärwaffe zu dienen. Die Waffe führt sich beinahe ebenso leicht und schnell wie ein Dolch, verursacht aber aufgrund seiner größeren Klinge erheblich mehr Schaden.
Das Kurzschwert fand sich auch oft am Gürtel des einfachen Mannes, zumindest bei denen, die es sich leisten konnten und damit umzugehen verstanden. In einer Stadt konnte es sehr nützlich sein, ein Kurzschwert zu besitzen, denn es ließ sich sehr diskret tragen oder sogar verbergen, und selbst, wenn es offen getragen wurde, zog es weniger Aufmerksamkeit auf sich, als wenn man sich einen Anderthalb- oder Zweihänder auf den Rücken geschnallt oder ein normales Schwert am Gürtel getragen hätte. Außerdem läßt es sich wegen seiner geringen Größe auch ausgezeichnet im Handgemenge einsetzen, vor allem in beengten Verhältnissen, wo jede längere Waffe nur hinderlich wäre.
-------------------------------------------------------------------------
Das Breitschwert:
Solche Schwerter wurden am zweckmäßigsten in Verbindung mit einem Schild geführt. Die breite Spitze des Schwertes verhindert, daß mit der Waffe effizient zugestochen werden kann. Es ist in erster Linie eine Hiebwaffe, für echte Fechtaktionen, Klinge gegen Klinge, wie wir sie aus späteren Jahrhunderten kennen, eigneten sich solche Schwerter jedoch nicht. Die breite Klinge war so schwer, daß der Hieb zwar möglichst wuchtig geführt werden konnte, solch einen Hieb aber abzufangen, falls er daneben ging, war wegen des einhändigen Gefäßes aber so gut wie unmöglich.
Die Paraden, die ein Kämpfer mit einem solchen Schwert ausführen konnte, waren deshalb naturgemäß sehr eingeschränkt, weshalb praktisch jeder, der damals in die Schlacht ging, einen Schild mit sich führte, auch wenn er nicht als Kavallerist einen Lanzenstoß abwehren mußte.
Das Breitschwert ist nur wenig wirkungsvoller oder effizienter als andere vergleichbar große Schwerter, beeindruckt aber durch sein wuchtiges Aussehen. Dennoch stellt es eine solide, zuverlässige Waffe dar. Mit dem Breitschwert kann man durchaus die Glieder einer Kettenrüstung auseinanderschlagen und sie in die Wunde bohren. Das Breitschwert war sogar noch die typische Waffe der schweren Kavallerie vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.
-------------------------------------------------------------------------
Der schwere Zweihänder:
So "klein" die für die Renaissance typischen Seitenwaffen waren, so groß sind die ebenso typischen Bidenhänder. Obwohl schon in den vorhergehenden Jahrhunderten Zweihänder geführt wurden, übertreffen die mannshohen Zweihandschwerter der Landsknechte sie in ihren Ausmaßen bei weitem. Die Bidenhänder werden oft 160 bis zu 190 Zentimeter lang, wobei etwa 1,15 bis 1,50 Meter auf die doppelschneidige Klinge bei 5 bis 10 cm Breite am Heft und 50 cm auf die Grifflänge entfallen, und wiegen mit ihren 50 bis 60 cm breiten Parierstangen etwa zwei bis sechs Kilogramm.
Durch die gute Ausbalancierung der Waffe wirken die zwei bis sechs Kilogramm schweren Waffen erstaunlich leicht. Um einen Zweihänder wirkungsvoll zu führen, also mit ihm zu fechten und nicht bloß zuzuschlagen, bedarf es dennoch einer soliden Ausbildung und einiger Kraft, denn die etwas unhandliche Waffe ist doch recht massig.
Seine volle Wirkung entfaltet das mächtige Schwert durch seine Länge im Kampf gegen mehrere Gegner und gegen Reiter. Im 15. Jahrhundert holten schweizer Söldner damit die Ritterheere reihenweise von den Pferden. Er eignet sich außerdem hervorragend dazu, schwer gepanzerte Ritter zu spalten. In Räumen und Gängen ist das große Schwert jedoch kaum einzusetzen, und auch bei Reisen erweist es sich als schwer und unhandlich. Schnelle Manöver sind damit nur schwierig durchführbar. Dafür entfaltet die Waffe bei einem Treffer allerdings eine gewaltige Wucht.
Im Handgemenge ist sie jedoch nur bedingt tauglich, und muß notfalls mit der zweiten Hand an der Klinge gepackt und wie eine Stabwaffe geführt werden, obwohl manche Exemplare über eigens zu diesem Zweck geformte, dolchartige Parierstangen mit nach vorne gebogenen Spitzen oder ähnliches verfügen.
Wie alle zweihändigen Schwerter ist dies eine Waffe für Fußsoldaten, die nicht vom Pferd aus verwendet werden kann. Trotz all der Kniffe, die Hände des Landsknechtes vor Hieben zu schützen, und der Bemühungen der Schmiede, für eine gute Balance der Waffe zu sorgen, ist der wahre Kampfwert des Bidenhänders im Krieg umstritten.
Die Theorie der Historiker will wissen, daß in der Schlacht, die mit Bidenhändern ausgerüsteten Landsknechte zwischen den eigenen Langspießen nach vorn stürmen und Breschen in die gegnerische Pikenformation schlagen sollten. Dabei versuchten sie angeblich, durch gezielte Hiebe die Spießschäfte der Gegner durchzuhauen.
Bei Licht betrachtet wird klar, wie wenig sinnvoll diese Theorie ist. Wie sollte man eine doch recht schwere und sperrige Waffe in dem unvorstellbaren Gedränge des Gevierthaufens benutzen, noch dazu, wenn die gegnerischen Spießträger nach dem Leben des Schwertkämpfers trachten? Ganz nebenbei ist es auch keineswegs einfach, den zähen Eschenschaft eines Langspießes durchzuhauen, der ja unter dem Hieb des Schwertes zurückfedert und ihm so einen Teil der Wirkung raubt.
Viel wahrscheinlicher erscheint es da, wenn man annimmt, daß der Bidenhänder von spezialisierten Einzelkämpfern gegen Reiter und Ritter und von den Trabanten, den Leibwächtern eines Befehlshabenden, getragen wurde, oder auch von den Bewachern der Regimentsfahne. Diese ehrenvollen Aufgaben erklären, warum die Kämpfer mit den Bidenhändern zu den sogenannten Doppelsöldnern zählten, die bessere (doppelte) Bezahlung als ihre Kameraden erhielten.
Daß die Bidenhänder im Rahmen dieser Aufgaben manchmal auch zum Kampf genutzt wurden, erscheint möglich und erklärt die Scharten in den Klingen der heute in den Museen ausgestellten Exemplare. Gegen einen Reiter ist das große Schwert auch zweifellos eine hervorragende Waffe, aber man benötigt Platz, um sie zu führen.
In der Mittelalter-Szene ist der Nutzen des Zweihänders allerdings auch atmosphärischer Natur, und das große Schwert wird dort völlig zu Recht mit großem Schaden in Verbindung gebracht. Das Tragen eines solchen Schwertes, etwa auf den Rücken geschnallt, kann sogar den Eindruck erwecken, daß der Träger, weniger daran interessiert ist, seinen eigenen Hals zu retten, als den Gegner um dessen Kopf zu erleichtern, denn er kann keinen schützenden Schild verwenden, und die schwere Waffe erschwert die Verteidigung.
Das Schwert ist zwar langsam und schwer, aber eben diese Masse braucht es, um seinen verheerenden Schaden anzurichten. Krieger, die einen Zweihänder führen, tragen normalerweise keine anderen großen oder mittleren Waffen. Bestenfalls führt man einen Dolch als letzten verzweifelten Ausweg mit sich und hat höchstens ein normales Schwert zusätzlich am Sattel befestigt, das sogenannte Sattelbaumschwert.
------------------------------------------------------------------------
Das Langschwert:
Das normale Schwert (engl. Sword, franz.: Glaive, arab.: Takuba) entspricht dem gotischen Ritterschwert des 12. und 13. Jahrhunderts. Es hat eine Länge von ca. 90 cm und wiegt etwa ein Kilogramm. Das Schwert ist die mittelalterlich-ritterliche Standardwaffe schlechthin. Es besteht aus einer langen, geraden und achsensymmetrischen Klinge, die an beiden Seiten geschliffen, also zweischneidig ist. Die Spitze befindet sich in der Längsachse der Klinge.
Der Schwerpunkt dieser Waffe liegt etwa in der Mitte. Dadurch kann man mit dem Schwert gut zustoßen und einen wuchtigen Schlag ausführen. Trotz der Spitze ist das Schwert eher eine Hieb- als eine Stichwaffe, und Anfang des 14. Jahrhunderts wurde es auch vorwiegend so eingesetzt. Die Untersuchung von Skeletten aus der damaligen Zeit zeigt, daß die Schläge schreckliche Knochenverletzungen verursachten, obwohl die Klinge nicht sonderlich scharf war.
Die vielzitierte Behauptung, die Blutrinne habe die Funktion, das Blut eines durchbohrten Gegners schneller ausströmen zu lassen, damit dieser an der Klinge verblute, ist blanker Unsinn. Ein durchstoßener Muskel zieht sich nämlich um die Klinge herum zusammen, um eben dies zu verhindern. Daher dienen die Parierstangen auch dazu, die Waffe mit beiden Händen im Leib des Feindes herumzudrehen, um die Wunde richtig aufzureißen.
Der Griff des Schwertes ist zumeist für eine Hand gedacht. Es gibt keine einheitliche Ausführung des Schwertes, denn sein Aussehen ist von Kultur zu Kultur verschieden und ändert sich auch über die Zeitepochen hinweg.
Zum Führen eines Schwertes gehört keine besondere Voraussetzung, aber man kämpft natürlich effizienter, wenn man den richtigen Umgang damit erlernt hat. Auch ohne große Körperkraft ist das Schwert leicht zu führen, und es eignet sich sowohl zum Hieb als auch zum Stich. Fechten ist auch auf engem Raum möglich, sofern es sich nicht um ein sehr großes Schwert handelt. Es ist recht schnell und relativ leicht für seine Größe und verursacht beträchtlichen Schaden.
Der Fechtstil wird immer durch den Armschwung bestimmt und kann nicht wie bei einem Rapier oder Degen aus dem Handgelenk gedreht werden. Daher ist ein Schwert immer langsamer als ein Rapier. Gegen Waffen hoher Reichweite (z.B. Stangenwaffen) wirkt sich seine geringere Länge jedoch negativ aus.
Das normale Schwert ist die typische Waffe des adligen Kriegers. Man mußte im Mittelalter mindestens ein Ritter sein um diese Waffe tragen zu dürfen. Erst mit der Schwertleite (Ritterschlag) erwirbt man das Recht ein Schwert tragen zu dürfen. Ein Knappe trug in der Regel ein Kurzschwert oder Sax und ein Söldner einen Anderthalb- oder Bidenhänder, aber kein Schwert wie ein Ritter.
-------------------------------------------------------------------------
Der Degen:
Der Degen war die Weiterentwicklung des Schwertes, die erst möglich wurde, als man auf schwere Rüstungen wegen ihrer Unwirksamkeit gegenüber Feuerwaffen verzichtete. Man benötigte nun keine besonders großen und schweren Schwerer zum Durchdringen von Plattenrüstungen mehr, sondern konnte sich auch leichtere, schmalere Schwerter konzentrieren, die mit der schnellen Technik des Stoßfechtens geführt werden konnten.
Eine genaue Unterscheidung zwischen Schwert, Degen und Rapier wurde in der Sprache der damaligen Zeit nicht getroffen. So wurde eine Waffe, die bis zu diesem Zeitpunkt als Schwert bezeichnet wurde, plötzlich Degen genannt, da dieser Ausdruck einfach modern war. Dennoch kann man eine grobe Kategorisierung vornehmen und schmale Klingenwaffen mit Korb als Degen bezeichnen.
Der Degen, im Grunde genommen keine Neuentwicklung des 16. Jahrhunderts, blieb extrem lange in Gebrauch. Die entferntesten Vorfahren des Degens kann man bereits in den Stoßschwertern der gotischen Zeit suchen. Wie diese wurde er hauptsächlich zum Stoß genutzt. Einige Exemplare waren aber durchaus zum Hieb geeignet, wenn sie auch nicht immer in der Lage waren, einem gut gerüsteten Gegner dadurch ernsthaft zu schaden.
Deshalb war der Degen zunächst eher eine Infanteriewaffe, denn unter dem Fußvolk war der Harnisch längst nicht so verbreitet wie bei der, immer noch durch die Ritterschaft geprägten, Kavallerie. Rapiere und Degen verdrängten in der Renaissance zunehmend das Schwert als Standesabzeichen und wurden bald zum Kleidungszubehör.
Man kann sich vorstellen, daß ein solch gefährliches Kleidungszubehör die Zahl der Duelle ins Unermeßliche ansteigen ließ. Um für ein Duell gewappnet zu sein, genügte es aber nicht, einen Degen an der Seite zu tragen, man mußte auch damit umgehen können. Fechtmeister wie Achille Marozzo, Camillo Agrippa und Capo Ferro da Cagli entwickelten eine ausgefeilte Fechtkunst, die als Vorläufer des heutigen sportlichen Fechtens gelten kann.
Die Fechtkunst des 16. Jahrhunderts bediente sich aber einiger "Tricks", die heute nicht mehr angewendet werden. Dazu gehören Linkhanddolche, kleine Faustschilde oder auch Mäntel. Der Mantel als Ersatz für einen Schild wurde schon früh von der Italienischen Schule eingesetzt. Der mit dem Mantel umwickelte linke Arm bietet einen relativ guten Schutz. Der Mantel wurde aber auch zum Binden der gegnerischen Klinge oder als Ablenkung und Sichtbehinderung genutzt. Mit all diesen Hilfsmitteln versuchte man, die Klinge des Gegners zu blockieren, falls die eigene Parade fehlschlagen sollte.
Manch einer ließ sich aber auch einen Degen anfertigen, dessen Klinge so lang war, daß sie ihm die im Kampf wichtige Reichweite garantierte. Diese Praxis war anscheinend gar nicht so selten. So mußte beispielsweise jeder, der mit seinem Degen die Stadtgrenzen Londons überschreiten wollte, seine Waffe den Wachtposten vorzeigen. Überschritt die Länge seiner Klinge das festgesetzte Maß von einem Yard (ca. 90 cm), wurde sie kurzerhand zurechtgestutzt, indem man dem Degen die Spitze abbrach.
-------------------------------------------------------------------------
Das Florett:
Im 16. Jahrhundert wurde das Florett (engl.: Foil, franz.: Fleuret) in der Zivilbevölkerung populär. Das Florett stellt die höchste Verfeinerung bei den langen, leichten Stichwaffen dar. Es ist aus dem Degen und dem Rapier entstanden, mit dem Ziel, eine sehr leichte und schnelle Stichwaffe zu entwickeln. Als sozusagen ziviler Verwandter des Degens war das Florett noch höher spezialisiert als dieser und als das Rapier.
Im Grunde ist es ein noch schmaleres Rapier, bei dem man auf eine Schneide ganz verzichtet hat. Die dünne, gerade und flexible Stahlklinge ist etwa 90 cm lang, rund, prismen-, rautenförmig, drei- oder vierkantig (heutige Sportflorette sind immer vierkantig) und endet in einer nadelfeinen, gehärteten Spitze.
Der Hauptverwendungszweck des nichtmilitärischen Floretts liegt in der Selbstverteidigung und im Duell, obwohl es eigentlich ursprüngich als reine Übungswaffe entwickelt worden war. So ist es ganz für den Stich ausgelegt und wurde zu einer reinen Stoßwaffe, mit der man keine Hiebe mehr führen kann, da diese eher einem Peitschenhieb gleichen und keinerlei schneidende Wirkung mehr besitzen. Zum Ausgleich ist diese Waffe ungeheuer leicht und schnell, und ihr moderater Schaden und ihre relative Länge machten sie ideal für jeden guten Fechter, reichen Adeligen und Draufgänger.
Die Technik des Florettfechtens erfordert eine sehr saubere Parade von Angriffen und schnelle Aktionen. Das Florett ist so ausbalanciert, daß der Schwerpunkt der Waffe ca. 5 cm vor dem Handschutz liegt, und es dadurch leicht gedreht werden kann, wobei das Gewicht der leichten Klinge durch einen schweren Griff/Handschutz kompensiert wird. Das Florett wird in der Regel von darauf spezialisierten Kämpfern zusammen mit dem Linkhanddolch (französischer Stil) oder dem Stilett (italienischer Stil) im Zweiwaffenstil verwendet.
------------------------------------------------------------------------
Das Katana:
Das Katana, das bekannteste japanische Schwert aus Lagenstahl, man könnte schon von einem "Nationalschwert" sprechen, ist gleichzeitig Symbol und Stolz der Samurai (jap.: Diener), der japanischen Ritter und des ländlichen Kriegeradels (buke). Es wird oft von Vater zu Sohn weitervererbt. Das Katana besitzt eine einschneidige, leicht gebogene Klinge mit rasiermesserscharfem Hohlschliff.
Das Katana wird mit der Schneide nach oben gesteckt im Gürtelband (Obi) getragen. Das japanische Schwert verdankt seinen Ruhm der überaus guten Bearbeitung, die unerläßlich war, um die hochgeschraubten Anforderungen an Schärfe und Festigkeit, die der Samurai für sein Schwert stellte, zu erfüllen. Eine umfangreiche altjapanische Literatur gibt darüber Auskunft, wenn es auch für unsere Begriffe recht makaber ist, den menschlichen Körper in Zonen des leichteren oder schwierigeren Zerschneidens zu gliedern, mit der Absicht, für alle diese Schwierigkeitsgrade Schärfe und Widerstandsfähigkeit im Katana zu entwickeln.
Das Katana ist das erste von zwei Schwertern eines Samurai, der noch eine kleinere Version des Katanas, das Wakizashi, führt. Ein Ronin (herrenloser Samurai) besitzt dagegen nur ein Katana, kein Wakizashi. Katanas konnten früher nur außerhalb Japans käuflich erworben werden, innerhalb des Landes wurden sie den Samurai von ihren Herren verliehen oder vom Vater vererbt und waren der normalen Bevölkerung nicht zugänglich, es sei denn, man stahl es oder nahm es als Beute von einem getöteten Samurai.
Normalerweise bekam man einen Satz Schwerter als Belohnung von einem östlichen Lehnsherren. Diese Verleihung war eine große Ehre und kam einem Ritterschlag gleich, verpflichtete aber auch zu unbedingter Gefolgschaft. Katanas sind sehr persönlich. Ein Samurai der sein Katana oder sein Wakizashi verloren hat, hat seine Ehre verloren. Dies ist auch im 35. Gesetz des Tokugawa Ieyasu geregelt: "Das Schwert ist die Seele des Samurai. Wer es verliert, ist entehrt und der strengsten Strafe verfallen."
Die traditionelle japanische Fechtkunst wird Kendo genannt. Ihre Geschichte geht bis weit vor das 9. Jahrhundert zurück. Wie sie aus alten Mythen und Kriegsromanen überliefert wurde, diente sie ursprünglich nur der Selbstverteidigung und nicht dem Angriff. In diesem Sinne war sie weder "Kendo" noch "Ken-Jutsu", sondern lediglich eine reine Schwerttechnik.
Gekämpft wurde mit einer Vorform des Katanas, dessen Klinge gerade verlief und somit eher dem Ninjato ähnelte. Im Kampf wurde mit dieser Waffe vor allem gestoßen, gestochen und geschlagen. Erst viel später sollte sich die Kunst des Schneidens entwickeln, wofür die Entwicklung des leicht gebogenen Katanas Voraussetzung war. Dies geschah im 9. Jahrhundert. Erst jetzt nahm Kendo, damals auch "Heiho", "Ken-Jutsu" oder "Geki-Ken" genannt, seinen eigentlichen Anfang.
Kendo wurde gegen Ende des 15. Jahrhunderts (Muromachi-Zeit) nach einheitlichen Gesichtspunkten systematisiert. Bis dahin hatte es einer Vielfalt individueller Ausführungsmöglichkeiten unterlegen. Mit dieser Vereinheitlichung wurden gegen Ende des 15. Jahrhunderts auch. die ersten Schulen (Ryu) gegründet, z.B. die Shinto-Ryu, Nen-Ryu, Chujo-Ryu und Kage-Ryu.
Die alten Kata-Formen (Übungsabläufe) bildeten damals die grundlegenden Übungen. Sie wurden mit dem Katana selbst oder mit dem Bokken oder Bokuto (beides Holzschwerter) ausgeführt. Im Kendo benutzt man außerdem das Shinai, welches aus geschlitzten, biegsamen Bambussträngen besteht. Es ist so schwer wie ein Katana, aber weich genug, um zusammen mit Körperschutz auch Vollkontakt-Übungen durchzuführen. Das Dojo (Trainingshalle) wurde zum Ort dieser Übungen. Im 17. Jahrhundert (Tokugawa-Zeit) diente Kendo hauptsächlich der Ausbildung des Samurai.
Zu jener Zeit verschmolz Kendo erstmals mit dem Begriff des "Bushido" (der Weg des Kriegers), einem wichtigen Begriff in der japanischen Geistesgeschichte und beanspruchte somit neben der reinen Technik auch die Ausformung einer geistigen Kraft. Das bedeutete für die Erziehung des Samurai, moralische Ziele wie Menschenliebe (zin), Gerechtigkeit (gi), Höflichkeit (rei), Klugheit (chi) und Glaube (shin) anzustreben. Die Verschmelzung des Kendo mit der Lehre des Buddhismus, aber auch des Konfuzianismus fand somit seinen Höhepunkt.
In der Meiji-Zeit (1868 bis 1912) unterlag Kendo vielen Prüfungen. Die Meiji-Restauration veränderte die politische Struktur in großem Maße. Die Modernisierung erfolgte in schnellen Schritten. Als Folge verlor die Bushi-Klasse (Samurai), deren Privileg es war, das Kendo auszuüben, an Ansehen und Rang. Damit einhergehend galt Kendo am Anfang der Meiji-Zeit als überholt und veraltet.
_________________
Bist du auf der Suche nach Reichtum und Macht? Dann tritt ein ...
Henk - Ein Krimineller aus Leidenschaft
Hektor Steinhauer - Rache ist sein Leben
Zuletzt geändert von Namenlos: 6.04.06, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
|